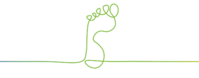Software, die Zoll, Trade Compliance und Logistik automatisiert und vereinfacht. So bleiben Ihre Waren in Bewegung und kommen pünktlich ans Ziel – KI-gestützt, schnell und zuverlässig. Und dabei stets 100 % konform mit allen Vorschriften.
AEB auf der LogiMAT 2026
Grenzenlose Effizienz und Zuverlässigkeit in Versand und Transportmanagement. Wie das gelingt, zeigt AEB vom 24. bis 26. März 2026 in Stuttgart auf der LogiMAT. Mit Cloud-Lösungen für Zoll, Trade Compliance und Logistik.

Logistik als Lebensretter bei Ärzte ohne Grenzen
AEB: Kompetenz in Außenwirtschaft und Logistik
100 %
Mitarbeiter*innen-geinhabt und unabhängig
750+
Mitarbeitende
15 in 8
Standorte in Ländern
7.000+
Unternehmen nutzen unsere Software
Waldo will die Welt sehen
Ein Wal als Kreativraum für Kinder und Jugendliche – mobil, hell und bereit, an jeden Ort zu kommen. Vielleicht auch zu Ihnen?
Im Mai hatte Waldo der Wal seine Premiere auf dem AEB get connected. Jetzt wartet er darauf, bei Vereinen zum Einsatz zu kommen. In Kooperation mit ART HELPS finden in Waldo kreative Workshops für Kinder und Jugendliche statt. Sie haben eine Idee, wo Waldo als nächstes hinschwimmen soll?
News und Infos zu Zoll & Außenwirtschaft
 Zollpolitikviolet23.02.2026
Zollpolitikviolet23.02.2026USA: Aktuelle Entwicklungen
Zollerhebungen seitens der Vereinigten Staaten von Amerika prägen die Schlagzeilen. Ein Zwischenfazit zu Aktionen und Reaktionen.
 Interviewviolet20.02.2026
Interviewviolet20.02.2026KI im Zoll 2026: Warum Automatisierung mehr braucht als nur künstliche Intelligenz
Daniel Schüler, AI Strategist bei AEB, warum KI allein keine strukturellen Probleme löst und weshalb Datenqualität, Prozessklarheit und strategische Automatisierung entscheidend sind. Menschenrechtered06.02.2026
Menschenrechtered06.02.2026Uyghur Forced Labor Prevention Act: Welche Auswirkungen hat das Gesetz?
Das UFLPA ist seit Juni 2022 in Kraft. Welche Maßnahmen wurden seitdem umgesetzt, was ist neu und was bedeutet das Gesetz für Sie?