Extraterritorialität: Einstieg und was Sie erwartet
Aktuelle Relevanz extraterritorialer Ansätze
Vorgaben und Erklärungen zur Extraterritorialität: EU
Vorgaben und Erklärungen zur Extraterritorialität: UK
Vorgaben und Erklärungen zur Extraterritorialität: CN
Vorgaben und Erklärungen zur Extraterritorialität: US EAR
Vorgaben und Erklärungen zur Extraterritorialität: US OFAC
Extraterritorialität in der Exportkontrolle: Fazit
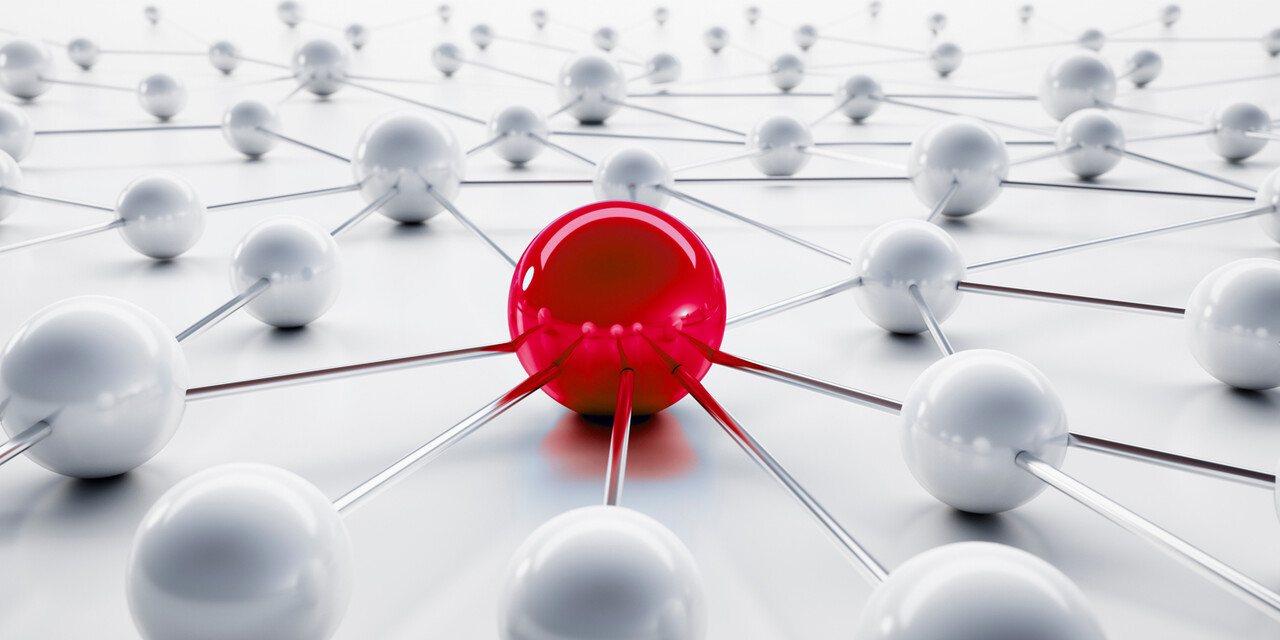
Extraterritoriale Ansätze in der Exportkontrolle: EU, UK, CN und US – was ist zu beachten?
Wie extraterritorial sind die Exportkontroll- und Sanktionsregelungen in der EU, dem UK, China und der USA ausgestaltet? Ein Blick in die Gesetze hilft bei der Einschätzung.






