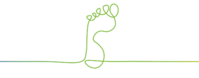Software, die Zoll, Trade Compliance und Logistik automatisiert und vereinfacht. So bleiben Ihre Waren in Bewegung und kommen pünktlich ans Ziel – KI-gestützt, schnell und zuverlässig. Und dabei stets 100 % konform mit allen Vorschriften.
Endress+Hauser optimiert globale Logistik mit Control Tower und TMS
Mehr Transparenz, verbesserte Service Level, niedrigere Kosten: Das Familienunternehmen profitiert vom AEB Transportation Management System.

Die neue Podcast-Folge im Video-Format!
Sebastian Bleser, VP Supply Chain beim Autoteile-Online-Händler Autodoc, berichtet über rasantes Wachstum - und wie das Global Trade Management mitwachsen muss.
AEB: Kompetenz in Außenwirtschaft und Logistik
100 %
mitarbeiter*innen-geinhabt und unabhängig
750+
Mitarbeitende
15 in 8
Standorte in Ländern
7.000+
Unternehmen nutzen unsere Software
News und Infos zu Zoll & Außenwirtschaft
 Zollpolitikviolet04.06.2025
Zollpolitikviolet04.06.2025USA: Aktuelle Entwicklungen
Zollerhebungen seitens der Vereinigten Staaten von Amerika prägen die Schlagzeilen 2025. Ein Zwischenfazit zu Aktionen, Reaktionen und „Zoll-Pausen".
 AEB Common Groundgradient04.06.2025
AEB Common Groundgradient04.06.2025Warum du AEB nur verstehen wirst, wenn du den Common Ground gelesen hast.
Der Common Ground ist unser User Interface. Dass seine neueste Überarbeitung sehr intensiv war, ist die schönste Beschreibung dafür, wie wir ticken. Absicherungviolet02.06.2025
Absicherungviolet02.06.2025Im Härtefall: Klauseln in internationalen Lieferverträgen
Können Zollerhöhungen ebenso wie höhere Gewalt („force majeure“) zu Vertragsauflösungen führen? Wer zahlt für den Schaden? Mehr zu Klauseln in Kaufverträgen.