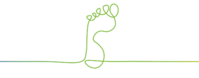Software, die Zoll, Trade Compliance und Logistik automatisiert und vereinfacht. So bleiben Ihre Waren in Bewegung und kommen pünktlich ans Ziel – KI-gestützt, schnell und zuverlässig. Und dabei stets 100 % konform mit allen Vorschriften.
Swissbit migriert mit AEB-Lösungen in die SAP® Public Cloud
Die Swissbit AG migriert seit 2024 von einem über zehn Jahre alten SAP® ECC-System in die SAP® Public Cloud. Ein Zwischenstand der strategischen Neuausrichtung mit Zoll- und Logistiklösungen von AEB.


Logistik als Lebensretter bei Ärzte ohne Grenzen
AEB: Kompetenz in Außenwirtschaft und Logistik
100 %
Mitarbeiter*innen-geinhabt und unabhängig
750+
Mitarbeitende
15 in 8
Standorte in Ländern
7.000+
Unternehmen nutzen unsere Software
Waldo will die Welt sehen
Ein Wal als Kreativraum für Kinder und Jugendliche – mobil, hell und bereit, an jeden Ort zu kommen. Vielleicht auch zu Ihnen?
Im Mai hatte Waldo der Wal seine Premiere auf dem AEB get connected. Jetzt wartet er darauf, bei Vereinen zum Einsatz zu kommen. In Kooperation mit ART HELPS finden in Waldo kreative Workshops für Kinder und Jugendliche statt. Sie haben eine Idee, wo Waldo als nächstes hinschwimmen soll?
News und Infos zu Zoll & Außenwirtschaft
 CO₂-Grenzausgleichviolet19.01.2026
CO₂-Grenzausgleichviolet19.01.2026CBAM - was Importeure jetzt wissen müssen
Der „Carbon Border Adjustment Mechanism“ (CBAM) verpflichtet Unternehmen, für emissionsintensive Importe ab 2027 Zertifikate zu erwerben. Erleichterungen brachte das Omnibus-Paket. Ein Ausblick.
 Sorgfaltspflichtenviolet19.12.2025
Sorgfaltspflichtenviolet19.12.2025Entwaldung: Ziel, Zeitplan und Pflichten der EUDR
Mit der EU Deforestation Regulation (EUDR) geht die EU gegen Entwaldung und Waldschädigung weltweit vor. Sie wurde überarbeitet und ist ab 30. Dezember 2026 anzuwenden. Dual-Use-Güterred15.11.2025
Dual-Use-Güterred15.11.2025Güterliste in Anhang I der EU-Dual-Use-VO aktualisiert
Der aktualisierte Anhang der EU-Dual-Use-VO (EU) 2021/821 ist am 15. November 2025 in Kraft getreten. Sind Ihre Dual-Use-Güter vom Update betroffen?