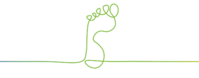Software, die Zoll, Trade Compliance und Logistik automatisiert und vereinfacht. So bleiben Ihre Waren in Bewegung und kommen pünktlich ans Ziel – KI-gestützt, schnell und zuverlässig. Und dabei stets 100 % konform mit allen Vorschriften.
Versandlogistik in SAP®: Wittensteins Erfolgsrezept
Der Hersteller von Antriebstechnik Wittenstein hat seine Logistikprozesse mit AEB Multi-Carrier-Software optimiert und die Exportabwicklung direkt mitgedacht. Beides ist tief in das eigene SAP®-ERP-System integriert.

Wie die Schweizer Zollwelt mit Passar in die Zukunft startet
Mit Passar kommt in der Schweiz ein komplett neues Warenverkehrssystem. Fredy erklärt, warum das System eingeführt wurde, welche Vorteile es bietet und wie Unternehmen den Umstieg meistern.
AEB: Kompetenz in Außenwirtschaft und Logistik
100 %
Mitarbeiter*innen-geinhabt und unabhängig
750+
Mitarbeitende
15 in 8
Standorte in Ländern
7.000+
Unternehmen nutzen unsere Software
Waldo will die Welt sehen
Ein Wal als Kreativraum für Kinder und Jugendliche – mobil, hell und bereit, an jeden Ort zu kommen. Vielleicht auch zu Ihnen?
Im Mai hatte Waldo der Wal seine Premiere auf dem AEB get connected. Jetzt wartet er darauf, bei Vereinen zum Einsatz zu kommen. In Kooperation mit ART HELPS finden in Waldo kreative Workshops für Kinder und Jugendliche statt. Sie haben eine Idee, wo Waldo als nächstes hinschwimmen soll?
News und Infos zu Zoll & Außenwirtschaft
 Ganz konkretred06.10.2025
Ganz konkretred06.10.2025Extraterritoriale Ansätze in der Exportkontrolle: EU, UK, CN und US – was ist zu beachten?
Wie extraterritorial sind die Exportkontroll- und Sanktionsregelungen in der EU, dem UK, China und der USA ausgestaltet? Ein Blick in die Gesetze hilft bei der Einschätzung.
 Interviewdarkblue15.09.2025
Interviewdarkblue15.09.2025SAP® BTP in Versand und Logistik: Wie Unternehmen die Potenziale nutzen können
Die Business Technology Plattform von SAP ist in aller Munde. Wir haben Dominik Wagenfort, SAP Intralogistics & Warehousing Business Unit Leader bei unserem Partner consolut, zu Chancen, Herausforderungen und Nutzen interviewt. Eventdarkblue28.08.2025
Eventdarkblue28.08.2025IFOY Awards 2026 werden im AEB HQ verliehen
Am 25. Juni 2026 trifft sich die internationale Logistik-Community bei AEB in Stuttgart. Dann werden die Trophäen des International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY) AWARD vergeben.